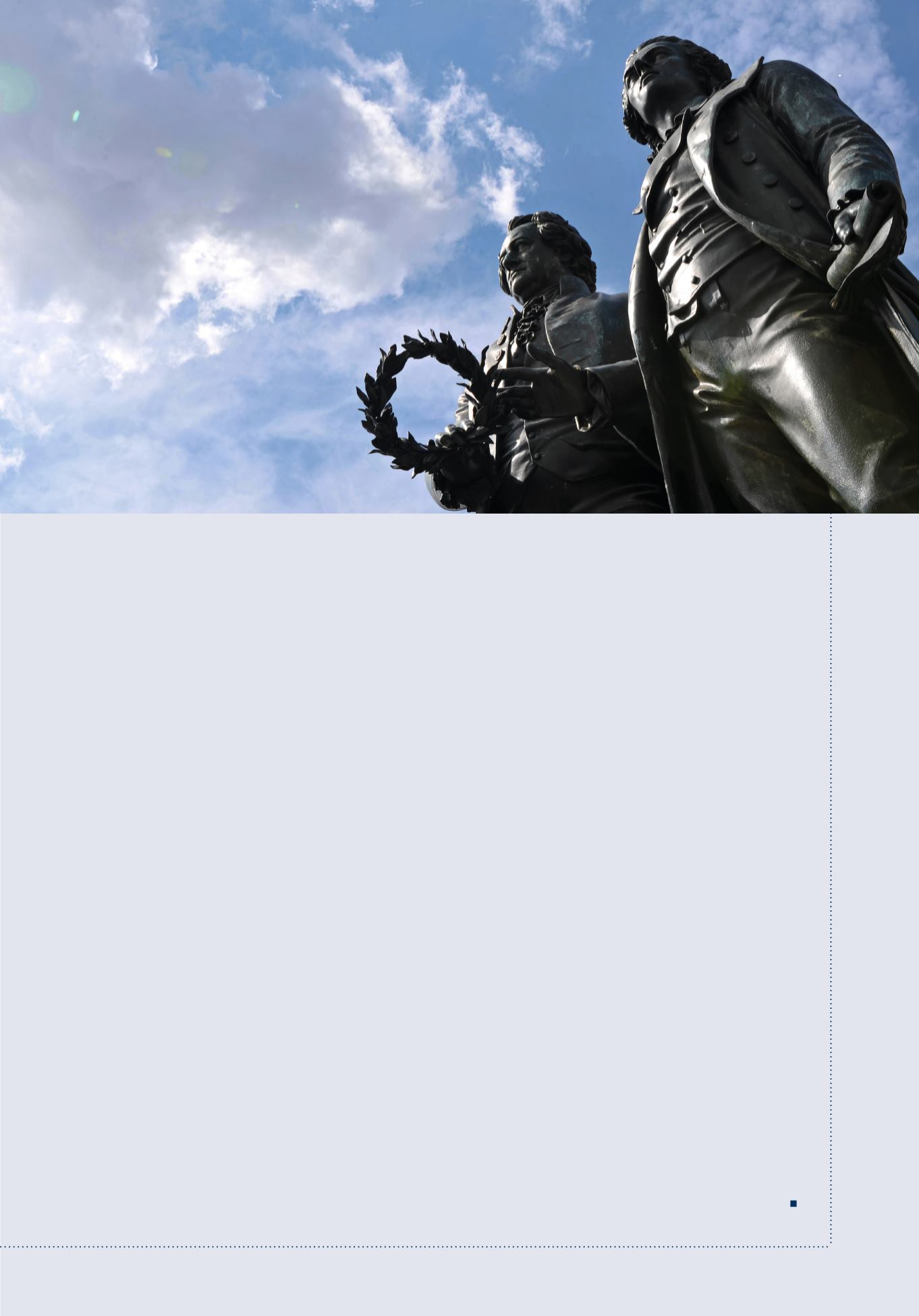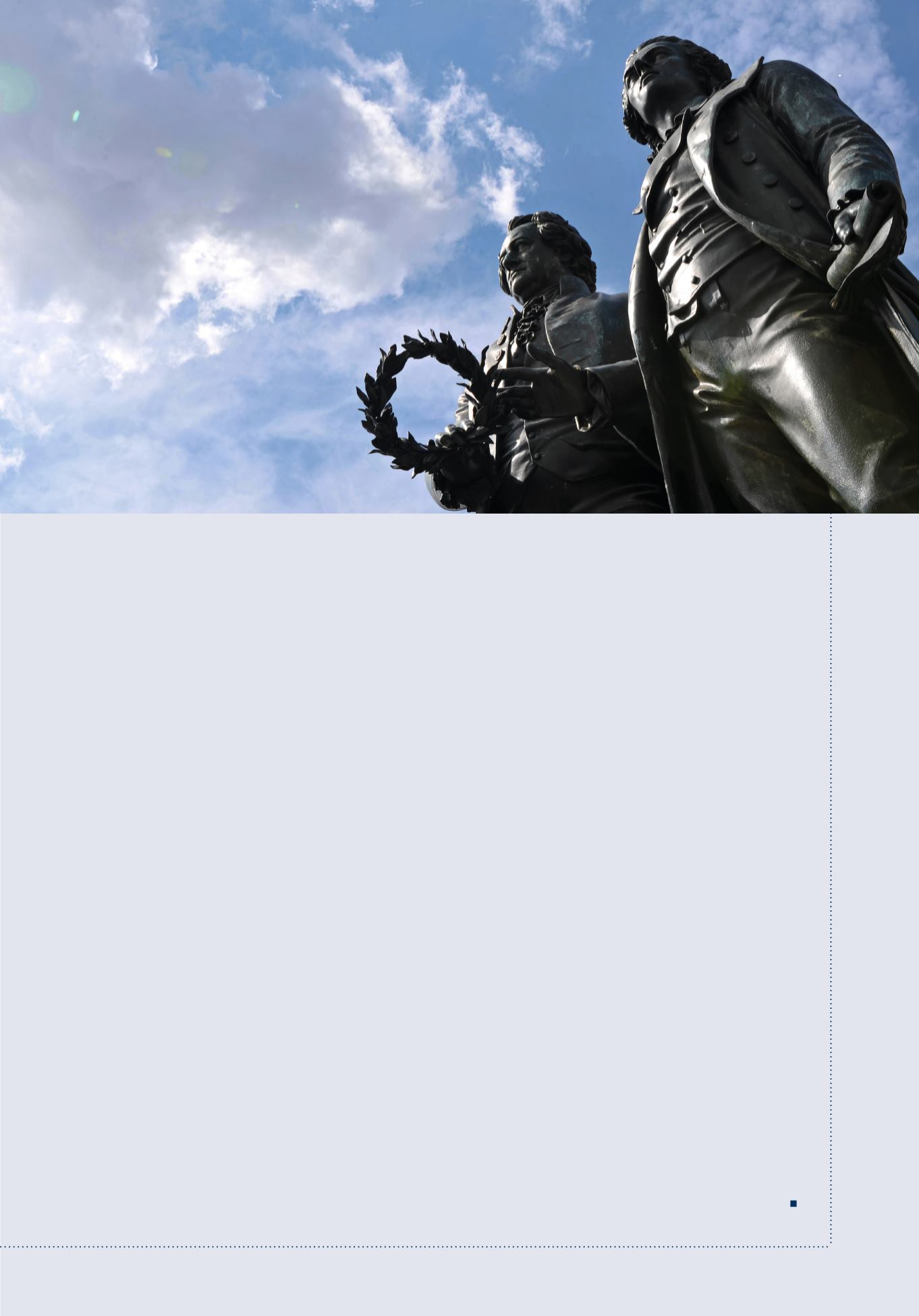
unter anderem die „Allgemeine Literatur-Zeitung“, das
seinerzeit umfänglichste, aktuellste und (insbesondere
durch das Eintreten für die Kantische Philosophie) intel-
lektuell modernste Rezensionsorgan in deutscher Spra-
che. Was die literarisch-wissenschaftliche Kritik betraf,
war Jena durch die „Allgemeine Literatur-Zeitung“ ein
publizistisches Zentrum. Was später „Weimarer Klassik“
genannt wird, beginnt als publizistischer Coup, die lite-
rarische Diskurshoheit zu gewinnen. Was dann „Jenaer
Romantik“ heißt, ist ein überbieterisches Seitenstück
dazu aus dembenachbartenAkademikerkreis.
In der Geschichte der Naturwissenschaften sindWeimar
und Jena als „exzentrische“ Orte bekannt geworden, an
denender indieserHinsicht ganzeinsameGoethegegen
Newton antrat und die romantische Naturphilosophie
Schellings sich vom Fortschritt der empirischen Natur-
forschung abkoppelte. Diese Punkte haben vergessen
lassen, dass mit der 1793 gegründeten „Naturforschen-
denGesellschaft zu Jena“undauchmit der herzoglichen
Förderung der experimentellenChemie, der Botanik und
mit dem Beginn der empirischen Psychologie ein viel
breiteres Spektrum der Wissenschaftskultur in Weimar-
Jena um 1800 herrschte. Die philosophisch-literarische
Kultur ist keine Parallelwelt neben den empirischenWis-
senschaften, sondern steht in engemBezug zu ihr.
„LaboratoriumAufklärung“
ImSommer 2010hat der Sonderforschungsbereichnach
zwölf Jahren seineHöchstförderungsdauer erreicht. Das
Engagement der Friedrich-Schiller-Universität für das
„EreignisWeimar-Jena“ ist damit aber nicht beendet. Im
Gegenteil. Das 2007 gegründete Forschungszentrum
„Laboratorium Aufklärung“ setzt die Arbeit fort und er-
weitert sie in zweifacher Hinsicht:
In historischer Perspektive geht es darum, das „Ereignis
Weimar-Jena“ als Teil der europäischenAufklärung zu ver-
stehen. Die deutsche Klassik und Frühromantik, auch die
klassische deutsche Philosophie sind keine nachaufkläre-
rischen Epochen, wie es die Literatur- und Philosophiege-
schichtedes19.bisweit ins20. Jahrhundert erzählthaben.
Sie gehören vielmehr zu der seit Mitte des 18. Jahrhun-
derts einsetzenden selbstreflexiven und selbstkritischen
Fortsetzung der Aufklärung. Die Bezeichnung „Laborato-
riumAufklärung“ setzt das Signal, diesen selbstreflexiven
und selbstkritischen Prozess als die entscheidende Bedin-
gungder „Kultur um 1800“ herauszuarbeiten.
Zusammen mit der Geschichte geht es dem „Labora-
torium Aufklärung“ um die Gegenwart: darum, welche
Präsenz und Relevanz die kanonischen Werke aus der
Zeit um 1800 heute haben oder neu gewinnen können,
undumdieFrage, obes aktuelleProblemkonstellationen
gibt, die durch einen Vergleichmit dem 18. Jahrhundert
neu und besser zu verstehen sind. Ein Beispiel: Wenn
wir heute mehr und mehr den politischen Relevanzver-
lust der nationalstaatlichen Ebene und dagegen den
Relevanzgewinn der internationalen wie der regionalen
Ebenen erleben, dann fordert das den Blick auf die Zeit
vor dem Nationalstaat heraus, also auf die politischen
Strukturenum1800.Was könnenwir aus der damaligen
Stratigraphie und Interaktion der Herrschafts- und politi-
schen Handlungsebenen lernen? Zu solchen Fragestel-
lungenbringt das„LaboratoriumAufklärung“historische
mit gegenwartbezogenen Forschungen zusammen.
wissenschaffen 41
universität jena.
weltweit vernetzt. thüringen verpflichtet.