
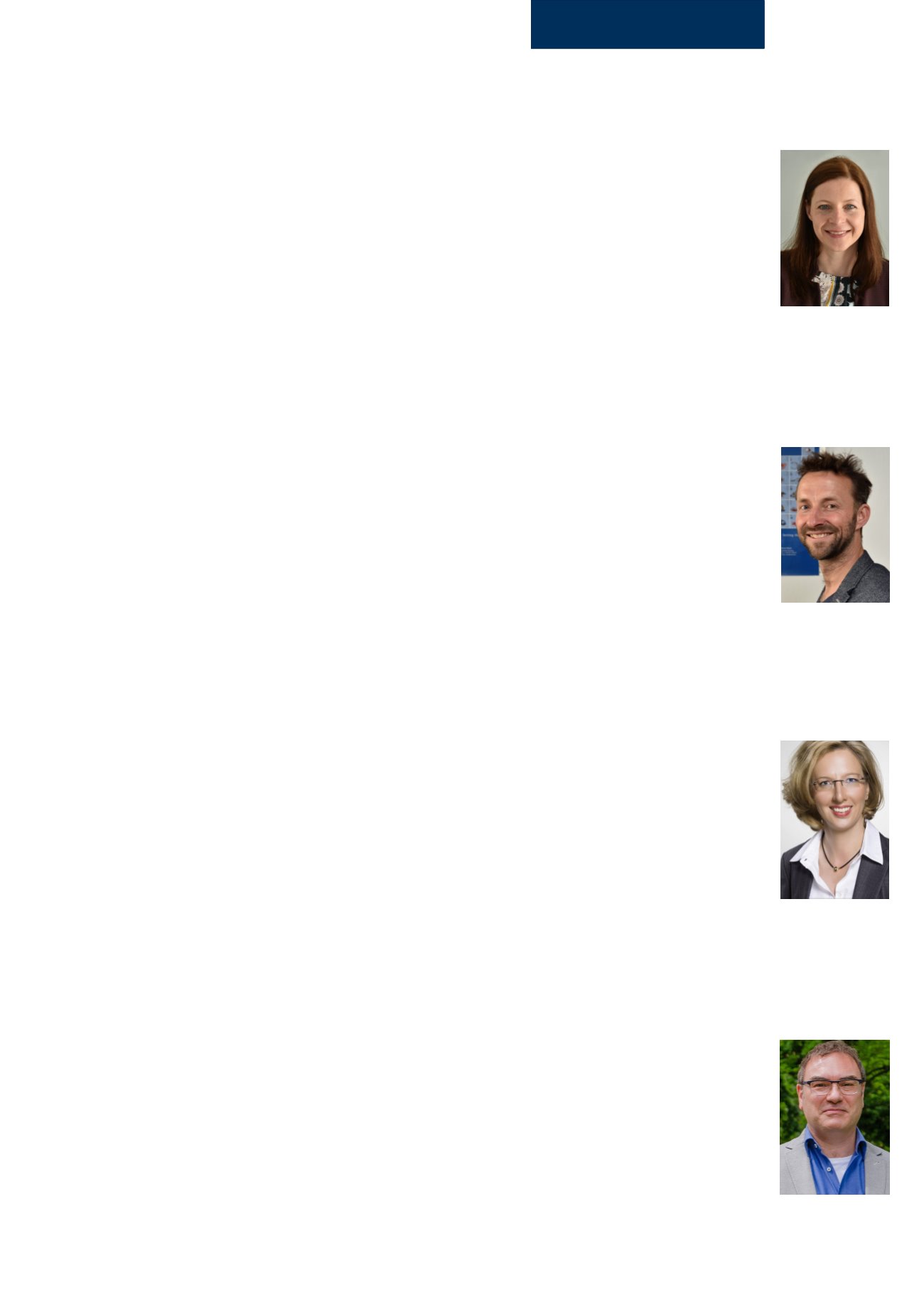
13
FSU-Newsletter/Sommer 2017
„Die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Zukunft“
Im Juni verkündete Trump, dass die
USA aus dem Pariser Klimavertrag aus-
steigen. „Einen Schritt zurück in die Ver-
gangenheit“, nennt das Prof. Dr. Roland
Zech, neuer Lehrstuhlinhaber für Physi-
sche Geographie. „Aber ein Zurück in die
Zeit, in der Industriestaaten ungebremst
Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen,
wird es dennoch nicht geben“, ist er sich
sicher. Denn ein Gutes habe Trumps An-
kündigung: Die Weltgemeinschaft hat in
seltener Einhelligkeit reagiert und hält an
ihren Klimazielen fest.
Der Klimawandel ist eines der zentra-
len Forschungsthemen des 40-Jährigen,
der von der Uni Bern an die FSU wech-
selte und weitaus größere Zeiträume im
Blick hat als in heutigen Debatten üblich.
Er liest in den „Archiven“ des Weltkli-
mas und rekonstruiert dessen Verlauf
viele zehntausende Jahre zurück. Nach
dem Geoökologie-Studium in Bayreuth
wechselte Zech nach Bern, wo er mit
einer Arbeit zur Vergletscherungsge-
schichte der Anden promoviert wurde.
Es folgten Aufenthalte in den USA und
die Rückkehr in die Schweiz. Von dort
zog es den Vater zweier Töchter nach
Jena. Hier möchte Zech die Studieren-
den stärker an den Klimawandel heran-
führen. „Durch die Analyse vergangener
Klimaveränderungen lassen sich Ansätze
zum Verständnis und vielleicht auch zur
besseren Bewältigung der aktuellen Si-
tuation finden“, sagt er. Die Vergangen-
heit sei der Schlüssel zur Zukunft. US
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen im Signalnetzwerk
Prof. Dr. Carsten Hoffmann möchte die
Signalprozesse in der Zelle in Echtzeit
abbilden, um sie zu verstehen. „Mit
modernsten Bildsensoren, ausgefeilter
Auslesetechnik und spezifischen Mar-
kierungstechniken können wir eine zeit-
liche Auflösung im Millisekundenbereich
erreichen und quasi beim Schalten von
Rezeptoren und Binden von Proteinen
zuschauen“, so der 50-jährige Chemiker,
seit diesem Semester Professor für Mo-
lekulare Zellbiologie am Uniklinikum und
Direktor des gleichnamigen Instituts.
Dabei konzentriert sich sein Interesse
auf die Funktion sogenannter G-Protein-
gekoppelter Rezeptoren, einer großen
Familie von Membranproteinen, die an
einer Vielzahl von Reizverarbeitungspro-
zessen beteiligt und Andockstelle für
30 Prozent der pharmazeutischen Wirk-
stoffe sind. Nach seinem Chemiestu-
dium in Bremen wurde Hoffmann von
der Uni Bremen promoviert und forschte
anschließend am National Institute of
Health in den USA. An der Uni Würzburg
wurde er habilitiert. Über den Sonderfor-
schungsbereich ReceptorLight hat Hoff-
mann schon sehr gute Kontakte nach
Jena, „und das Institut ist als Abteilung
des Zentrums für Molekulare Biome-
dizin der Universität bestens etabliert,
das erleichtert mir den Start immens.“
Das ermöglicht ihm auch, langsam in die
Koordination des Masterstudienganges
Molekulare Medizin hineinzuwachsen,
die in seinem Institut liegt.
vdG
Möglichst individuelle Anpassung der Strahlung
Die Behandlung von Patienten vom
Säugling bis zum Greis, mit gut- und bös-
artigen Erkrankungen vom Hirn bis zur
Ferse, in Zusammenarbeit mit fast allen
anderen medizinischen Fachrichtungen
und imTeam mit Naturwissenschaftlern,
medizinisch-technischen Assistenten
und Pflegespezialisten – Andrea Wittig,
die neue Professorin für Strahlenthera-
pie, hat viele Gründe, warum sie sich für
ihr Fachgebiet entschieden hat. Ionisie-
rende Strahlung ist eine der Säulen in
der Krebstherapie, entsprechend ist ein
Großteil der Patienten der Klinik wegen
Tumoren oder Metastasen in Behand-
lung. Aber auch gutartige entzündliche
Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Fer-
sensporn, werden bestrahlt. „Die Präzi-
sion und die Spezifität der Therapie wer-
den ständig weiterentwickelt, mit dem
Ziel einer effektiven Behandlung der
Zielstrukturen und der bestmöglichen
Schonung der umliegenden Gewebe
und Organe“, so die 46-Jährige.
Sie studierte Humanmedizin an der
Uni Essen, wo sie auch promoviert
wurde und sich zu einer speziellen Form
der Partikelstrahlentherapie habilitierte.
Sie arbeitete am Uniklinikum Essen
und wechselte danach an die Klinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie in
Marburg/Gießen. Oft sei die Strahlen-
therapie im Studium unterrepräsentiert,
deshalb freut sich Wittig, dass FSU-Stu-
dierende deren Vielfalt im praktischen
Jahr kennenlernen können.
vdG
Personalia
Prof.Dr.Roland
Zech.
Foto:Wäldchen
Prof.Dr.Carsten
Hoffmann.
Foto:Günther
Schlechtere Berufsperspektiven für hochqualifizierte Frauen
„Prepare your daughter for working
life – give her less pocket money than
your son”. Das Poster im Büro von Prof.
Dr. Kathrin Leuze bringt ihre Forschung
auf den Punkt. Dass Frauen schlechter
bezahlt werden als Männer, ist längst
bekannt. Die neu berufene Professorin
für Methoden der empirischen Sozial-
forschung und Sozialstrukturanalyse be-
richtet darüber hinaus, dass oft bereits
die Studienfach- und Berufswahl den
Grundstein dafür legt. Während Männer
häufiger Ingenieurwesen oder Natur-
wissenschaften studieren, schreiben
sich mehr Frauen in Geistes- und Sozial-
wissenschaften ein – „und wählen damit
Berufsfelder, die potenziell schlechter
bezahlt werden.“
Leuzes Promotion an der Uni Bre-
men folgte die Mitarbeit am Wis-
senschaftszentrum Berlin für So-
zialforschung in einem Projekt zu
Geldverwaltung und -verteilung in Part-
nerschaften. Danach lehrte die Bildungs-
soziologin, gebürtig aus dem bayrischen
Mühldorf am Inn, an der FU Berlin und
in Hannover. Künftig will sie weiter zu
innerpartnerschaftlichen Ungleichheiten
forschen. „Normativ gesehen müssten
beide Partner die gleichen Rechte und
Pflichten haben. Aber sogar wenn beide
berufstätig sind, arbeiten die Männer in
der Regel mehr und Frauen kümmern
sich zum großenTeil um das Private, den
Haushalt, Kinder – selbst wenn sie mehr
verdienen als ihre Partner“, so Leuze. jd
Prof.Dr.Kathrin
Leuze.
Foto:Günther
Prof.Dr.Andrea
Wittig.
Foto:Laackmann
















