
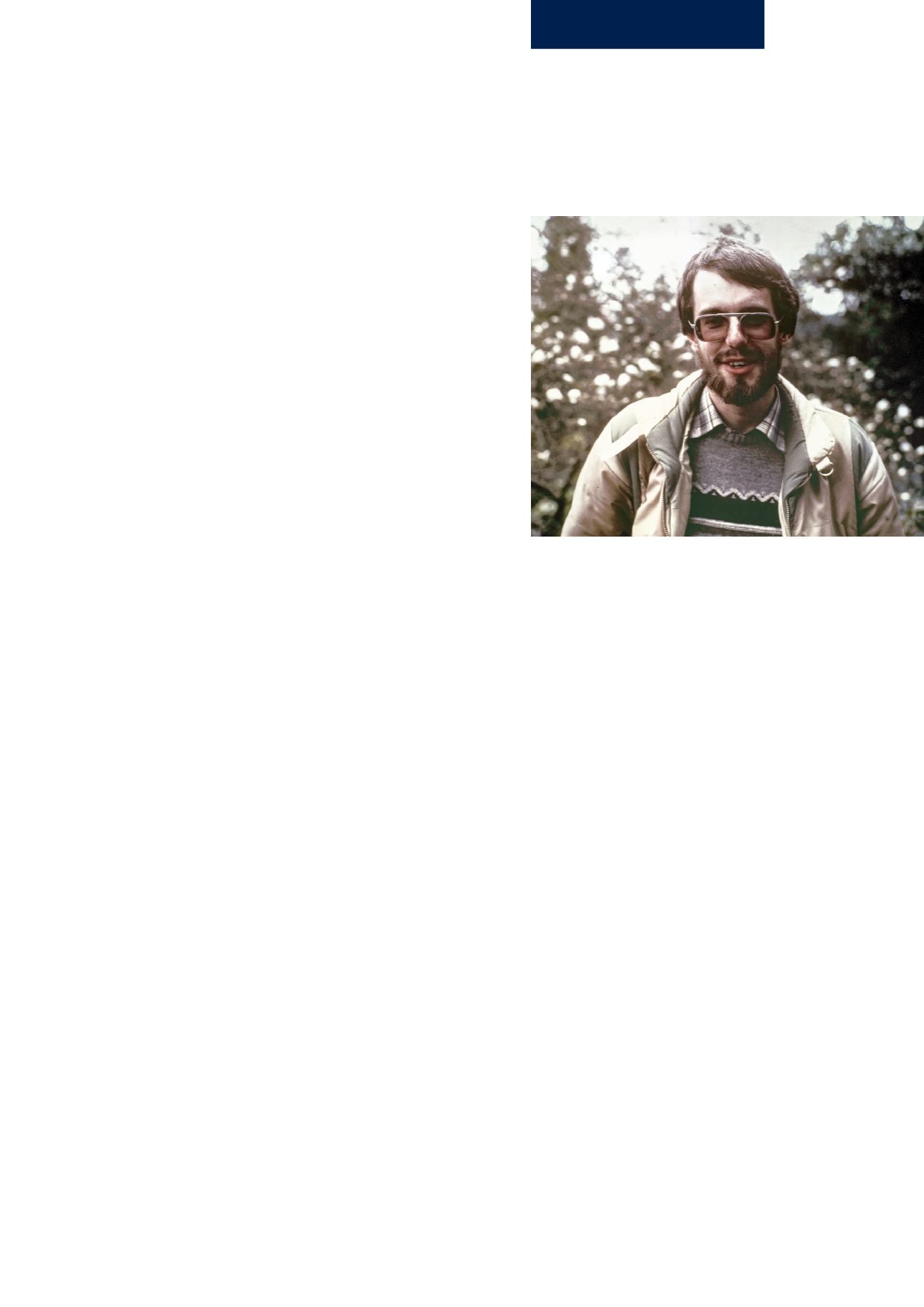
41
Uni-Journal Jena07/15
FSU intern
Ich war (k)ein alter Streber
Mein erstes Semester: Prof. Dr. Klaus Küspert
Wie haben Sie Ihr 1. Semester erlebt?
Ich habe ab 1975 Informatik mit Ne-
benfach „Betriebliche Anwendungen“
an der TH (heute TU) in Darmstadt stu-
diert – also vor genau 40 Jahren begon-
nen. Das Elternhaus befand sich imTau-
nus, wo ich auch 1974 Abitur gemacht
hatte, etwa (nur) 60 km von Darmstadt
entfernt. Es gab Kommilitonen, die ähn-
liche Entfernungen von daheim hatten
und täglich gependelt sind. Das wollte
ich mir aber nicht antun und hatte ein
möbliertes Zimmer am Studienort. Ich
war aber stets Wochenendpendler, bin
nur in Prüfungszeiten mal am Wochen-
ende am Studienort geblieben. Ich bin
also seit langem „pendelerfahren“.
Was hat Ihnen beim Eingewöhnen in
den Lebensraum Universität geholfen
und wo gab es Probleme?
1975 war Informatik ein junges Stu-
dienfach, das erst seit wenigen Jahren
an bundesdeutschen Universitäten an-
geboten wurde. Aber man konnte 1975
immerhin schon zwischen zwölf Infor-
matikhauptfachstandorten auswählen.
D. h., so ganz einfach auswählen doch
nicht: Informatik war ein sogenanntes
ZVS-Fach, die Studienplätze wurden also
von der Zentralstelle für die Vergabe von
Studienplätzen (ZVS) in Dortmund ver-
geben. Man bekam den ZVS-Bescheid
und kurz darauf, zwei oder drei Wochen
später, musste man am jeweils zugeteil-
ten (bei mir war’s auch der gewünschte)
Studienort antreten.
Das war schon ein Paradigmen-
wechsel: von der Schulzeit bzw. zwi-
schenliegendem Wehrdienst am ersten
Studientag gleich morgens in der Ana-
lysis-Vorlesung zu sitzen und wenig bis
gar nichts zu verstehen. Einführungsver-
anstaltungen mit Vorstellung des Studi-
ums gab es nur marginal. Man musste
sich seinen Plan an -zig Meter langen
Aushängen am zentralen Studentensek
retariat heraussuchen und war reichlich
orientierungslos zunächst. Geholfen hat
das baldige nähere Kennenlernen von
Leidensgenossen, Kommilitonen also,
und das Sprechen über Probleme – fach-
lich, organisatorisch und darüber hinaus.
Die „Schwarmintelligenz“ half also, die
Uni hingegen half einem diesbezüglich
damals nur sehr wenig. Das ist heute
zum Glück anders und besser geregelt.
Waren Sie chaotisch oder bestens or-
ganisiert? Einzelkämpfer oder Grup-
penlerner?
Ich war bestens organisiert: In mei-
nem Zimmer lagen – damals – keine Blät-
ter lose herum, kein einziges. Da hatte
ich hohe Gründlichkeit. Ich habe sogar
die Vorlesungsmitschriften mit Lochver-
stärkungsringen versehen abgelegt für
die Ewigkeit. Und ich war absolut ein
Gruppenlerner bzw. gewissermaßen bei-
des: Man kann nicht nur in Gruppen ler-
nen und dann abwarten und Tee trinken
bis zum nächsten Gruppentermin. Man
muss auch zwischendurch solo rackern.
Wir waren eine eng befreundete Klein-
gruppe von etwa fünf Kommilitonen und
haben meist mehrmals wöchentlich zu-
sammen gelernt und uns geholfen. Das
fand ich absolut „überlebens“-wichtig.
Was war das Wichtigste/Beste am
ersten Semester?
Ehrlich gesagt, genossen habe ich
es nicht wirklich, dafür war es wirklich
zu hart. Ich kam damals aus einem nor-
malen Gymnasium mit mathematisch-
naturwissenschaftlichem Zweig, aber
Leistungskurse gab es noch nicht. Ich
musste schon gewaltig ums Überleben
kämpfen. So gesehen, waren das Beste
am ersten Semester wahrscheinlich die
freienTage überWeihnachten oder etwa
der Buß- und Bettag – man hatte end-
lich mal für ein paar Tage keine Lehrver-
anstaltungen und konnte daheim Stoff
aufholen und lernen. Erleichterung dann
gegen Ende des Semesters, als man
doch die Klausuren zur eigenen großen
Überraschung bestehen konnte – nicht
immer alles gleich brillant, aber bestan-
den.
Sind Sie immer zu allen Vorlesungen
gegangen?
Jawohl – ich habe so gut wie nie eine
Lehrveranstaltung verpasst. Ich war ein
alter Streber. Nein, es lag wirklich an je-
nem genannten „Überlebenskampf und
-training“. Bei Verpassen von Lehrveran-
staltungen hätte man sich sofort Sorgen
über die Konsequenzen gemacht (also
Lücken im prüfungsrelevanten Wissen).
Und PDF-Dokumente zum Herunterla-
den und Nachholen des Stoffs gab es
halt noch nicht. Ich bin aber auch heute
noch ein Verfechter von Präsenz in Lehr-
veranstaltungen und sage den Studie-
renden manchmal etwas provokant,
dass wir die Präsenz-Uni Jena und nicht
die Fern-Uni Hagen sind – was nicht kri-
tisch gegen Hagen gemeint ist... Einige
Studierende hören das nicht so gerne,
aber da müssen sie durch.
Dachten Sie mal daran aufzugeben?
Nicht an freiwilliges Aufgeben, eher
an möglicherweise erzwungenes. Im
ersten Semester rauchte die Rübe eben
schon enorm und ich dachte mit Grausen
an die Prüfungen am Semesterende. Da
überlegt man schon, ob man seine Alter-
native in einer Ausbildung als Straßen-
bahnfahrer in Darmstadt suchen sollte –
aber vielleicht ist jene Ausbildung auch
nicht „ohne“. Aber letztendlich kam es
anders, wie man sieht. Ich denke, das
sollte man auch als Appell an heutige
Studierende sehen: Auch mal Ranklot-
zen und sich durchbeißen, es bleibt ei-
nem schon nicht alles an Studieninhalten
im Halse stecken.
Was stand neben dem Studienplan
auf Ihrem Programm?
Das Studium war schon sehr dominie-
rend zeitlich. Aber ab dem zweiten Se-
mester – als man merkte: schau an, es
geht ja doch – habe ich mir dann auch zu-
sätzlich neben der Pflicht eine gewisse
Kür im Studium erlaubt. So hörte ich
z. B. 1976/77 „Einführung in die Volks-
wirtschaftslehre“ bei einem jungen,
neu berufenen Professor namens Bert
Rürup. So lernte und lernt man zufällig
„Promis“ kennen zu einer Zeit, als sie
noch keine waren und nicht abzusehen
war, dass sie welche würden. Auch in
der Programmierung habe ich mir man-
che Kürlehrveranstaltung erlaubt. Es
geht sicher fast jedem so: Kür macht
wesentlich mehr Spaß als Pflicht. Und
bringt Nutzen, denn vieles davon konnte
man in der Tat später brauchen im Stu-
dium und danach. Also „nur zu“ lautet
der Appell auch an heutige Studierende
diesbezüglich.
KlausKüspertstar-
tetevor40Jahren
seinStudiumim
damalsganzjungen
FachInformatik.
Heutehaterden
LehrstuhlfürDaten-
bankenundInforma-
tionssystemeinne.
Foto:privat



















