
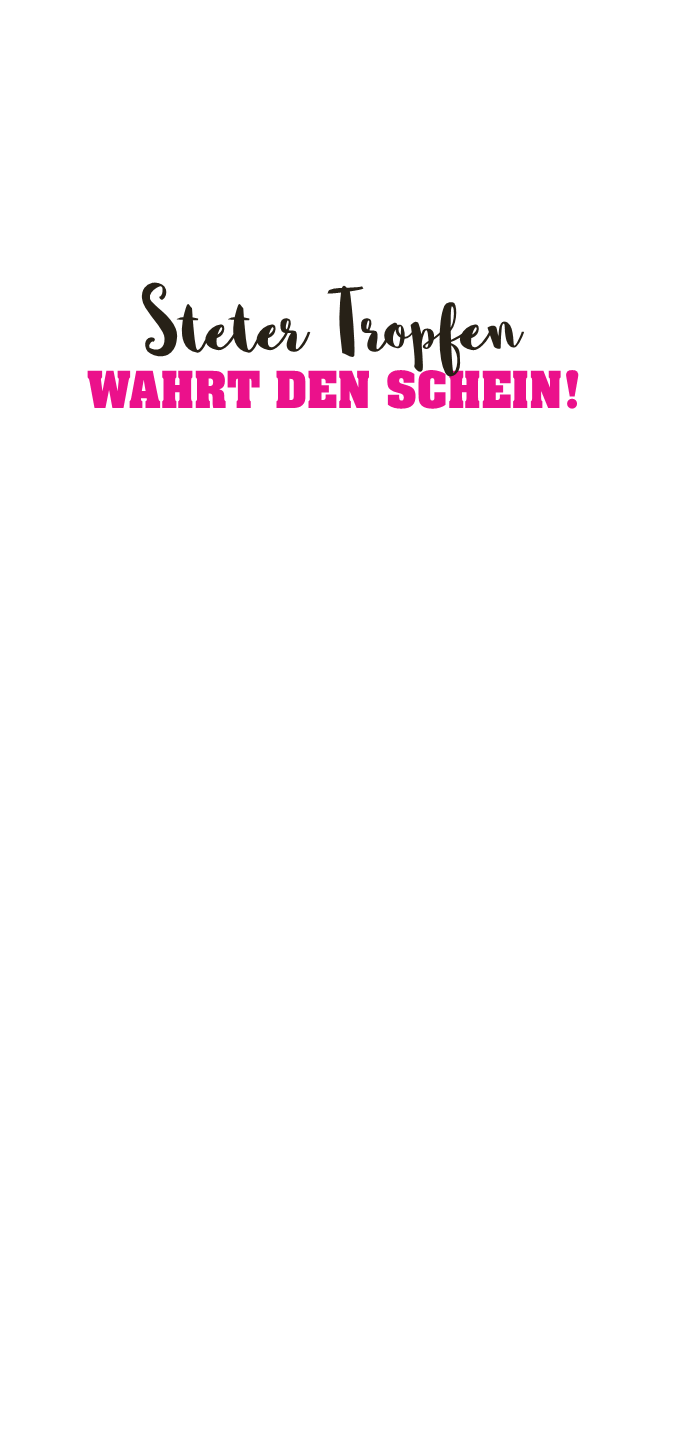
21
Aus Geschlechterperspektive scheint in der Promoti-
onsphase alles noch in Ordnung zu sein, immerhin
wurden 2015 in Thüringen 46,8 % der Promotionen von
Frauen erbracht
i
– Unterschiede in der Verteilung der
Geschlechter zeigen sich lediglich, wie bereits im Stu-
dium, zwischen den verschiedenen Fachbereichen
ii
und den einzelnen Hochschulen.
iii
Doch beginnt bereits hier das „akademische Frauen
sterben“
iv
– die Gründe sind so vielfältig wie schwer zu
greifen, weil nicht nur „harte“, sondern auch „weiche
Faktoren“
v
vor allem Frauen daran hindern, eine Pro-
motion zu beenden bzw. mit erlangtem Doktorgrad in
der Wissenschaft zu verbleiben.
vi
Ein „harter Faktor“ sind die prekären Beschäftigungs-
verhältnisse, welche sich durch den gesamten uni-
versitären Mittelbau ziehen: Wissenschaftlerinnen
sind zumeist auf statusniedrigeren Positionen mit
befristeten (Teilzeit-)Verträgen angesiedelt, die meist
mit kürzerer Laufzeit und weniger Forschungsmitteln
einhergehen – verbunden mit höherem Arbeitslosig-
keitsrisiko, geringerer Entlohnung und geringerer be-
ruflicher Integration.
vii
So promovieren Frauen häufiger
auf der Grundlage von Stipendien, was durch die ver-
einzelte Arbeitssituation die Integration in die „scien-
tific community” erschwert.
viii
Undine Fölsche
Promotion



















